Bildungskarenz: Fortschritt für Niedrigbezahlte, Rückschritt für Frauen
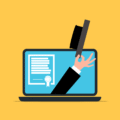
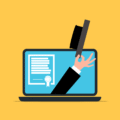
Mit Ende September läuft die Begutachtungsfrist für die Neuregelung der Bildungskarenz – die sogenannte „Weiterbildungszeit“ – aus. Ab 2026 sollen die Pläne in Kraft treten. Unsere Analyse zeigt: Die Reform bringt zwar verteilungspolitische Verbesserungen vor allem für Menschen mit geringen Einkommen, verschärft aber die Zugangshürden, sodass insbesondere Frauen deutlich seltener profitieren.
Der Mindesttagsatz des Weiterbildungsgeldes steigt von unter 15 Euro auf 40,40 Euro pro Tag – fast eine Verdreifachung im Vergleich zur alten Regelung. Pro Monat beträgt das Weiterbildungsgeld also mindestens 1.212 Euro – je nach Einkommen können die Sätze bis zu 2.038 Euro betragen. Das kommt besonders Menschen mit geringen Einkommen zugute: In den untersten Einkommenszehnteln steigt das monatliche Weiterbildungsgeld um bis zu 449 Euro. Trotzdem bleibt das Niveau deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle von aktuell 1.661 Euro.
Gleichzeitig werden die Zugangsvoraussetzungen massiv verschärft: Wer Weiterbildung in Anspruch nehmen will, muss künftig zwölf Monate durchgehend im selben Betrieb gearbeitet haben – Akademiker:innen sogar vier Jahre. Nach einer Elternkarenz ist ein direkter Wechsel in die Weiterbildung ausgeschlossen, es müssen mindestens 26 Wochen dazwischenliegen. Zudem müssen künftig 20 Wochenstunden Weiterbildung nachgewiesen werden (Ausnahme nur für Eltern mit Kindern unter sieben Jahren: 16 Stunden).
Diese Hürden bevorzugen durchgängige Vollzeitkarrieren und erschweren den Zugang für Menschen mit kurzer Betriebszugehörigkeit, Jobunterbrechungen, Teilzeit oder Care-Verpflichtungen – das sind überwiegend Frauen. Frauen bekommen ihr erstes Kind durchschnittlich mit 31,6 Jahren (2024), das Durchschnittsalter bei Inanspruchnahme der alten Bildungskarenz lag bei etwa 32 Jahren. Für viele Mütter war die Bildungskarenz also eine Brücke zurück ins Berufsleben.
Auch bei der Betriebszugehörigkeit zeigt sich, dass die Neuregelung Frauen tendenziell von der Inanspruchnahme ausschließt bzw. sie erheblich erschwert: Frauen haben im Schnitt eine kürzere Betriebszugehörigkeit als Männer (9,1 vs. 10,3 Jahre). Deutlich mehr Frauen (rund 217.000) in Angestellten- oder freien Dienstnehmer:innen-Verhältnissen waren 2024 weniger als ein Jahr in einem Betrieb beschäftigt. Bei Männern in diesen Beschäftigungsverhältnissen waren es nur 173.000.
Empirische Studien zeigen, dass die bisherige Bildungskarenz gerade für Mütter eine Brücke zurück ins Berufsleben war. Zwölf Jahre nach Antritt lag die Beschäftigungsquote von Frauen mit Bildungskarenz um 3,1 Prozentpunkte höher als bei vergleichbaren Frauen ohne dieses Instrument. Auch die Einkommen dieser Frauen stiegen langfristig im Vergleich zu den Frauen in der Kontrollgruppe. Auch das Argument, Frauen hätten Bildungskarenz oft als „verlängerte Elternkarenz“ genutzt, greift zu kurz: Vielmehr fehlt vielerorts die Kinderbetreuung, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben ermöglichen würde.
Auf die Weiterbildungszeit gibt es weiterhin keinen Rechtsanspruch. Zusätzlich müssen Arbeitgeber:innen einer Weiterbildungszeit zustimmen und bei höheren Einkommen auch 15 Prozent der Kosten mittragen (ab 3.225 Euro Bruttomonatsverdienst). Internationale Studien zeigen, dass diese Zustimmungspflicht die Inanspruchnahme senkt: In Großbritannien etwa fielen nach Einführung einer Arbeitgeberzuzahlung die Weiterbildungsstarts um 26 Prozent (NAO 2019), und auch andere Untersuchungen belegen, dass Investitionen vor allem dort steigen, wo die Arbeitgeberkosten gering sind (VIVES 2025). Qualitative Befunde (IAB 2021) verweisen zudem auf mangelnde Bekanntheit, hohen bürokratischen Aufwand und geringe Attraktivität für kleinere Betriebe. Besonders betroffen sind Teilzeitkräfte, befristet Beschäftigte (Poulissen et al. 2023) und Mitarbeiter:innen in Kleinbetrieben – Faktoren, die überdurchschnittlich oft auf Frauen zutreffen.
Österreich steht vor enormen finanziellen und gesellschaftlichen Herausforderungen und Weiterbildung ist der Schlüssel, um Beschäftigte fit für neue Anforderungen zu machen. Das darf kein Privileg für Männer mit Vollzeitkarriere oder Akademiker:innen bleiben.
Das Momentum Institut empfiehlt, das Weiterbildungsgeld mindestens auf die Höhe der Armutsgefährdungsschwelle anzuheben, die Zustimmungspflicht von Arbeitgeber:innen durch einen Rechtsanspruch zu ersetzen und die Zugangsvoraussetzungen an die Lebensrealitäten von Frauen und Eltern anzupassen. Dazu gehören insbesondere geringere Mindeststunden für Eltern und die Möglichkeit, Weiterbildung unmittelbar nach der Elternkarenz aufzunehmen. Zusätzlich braucht es eine verpflichtende Väterkarenz sowie ein flächendeckendes, kostenloses Kinderbetreuungsangebot.